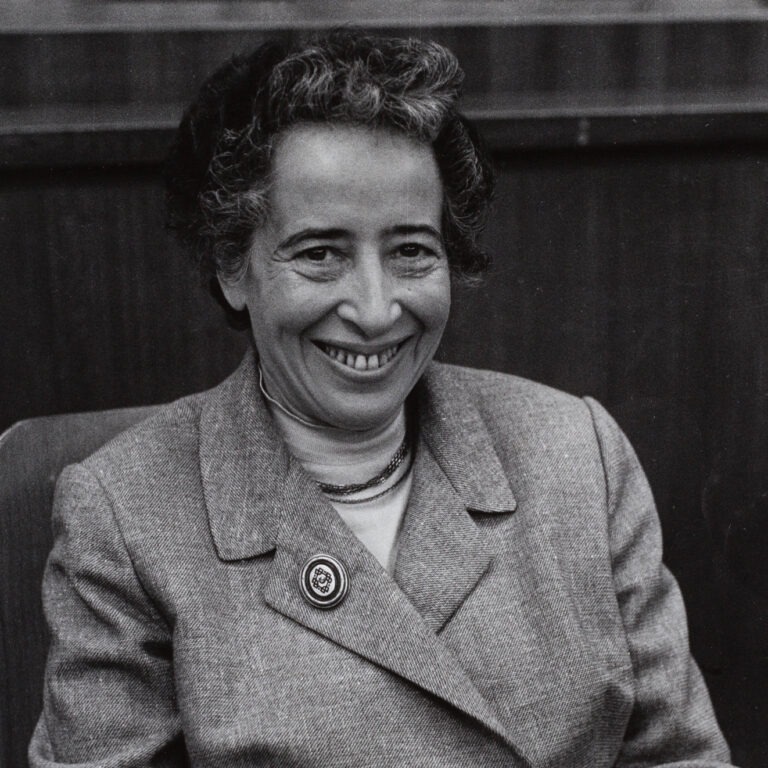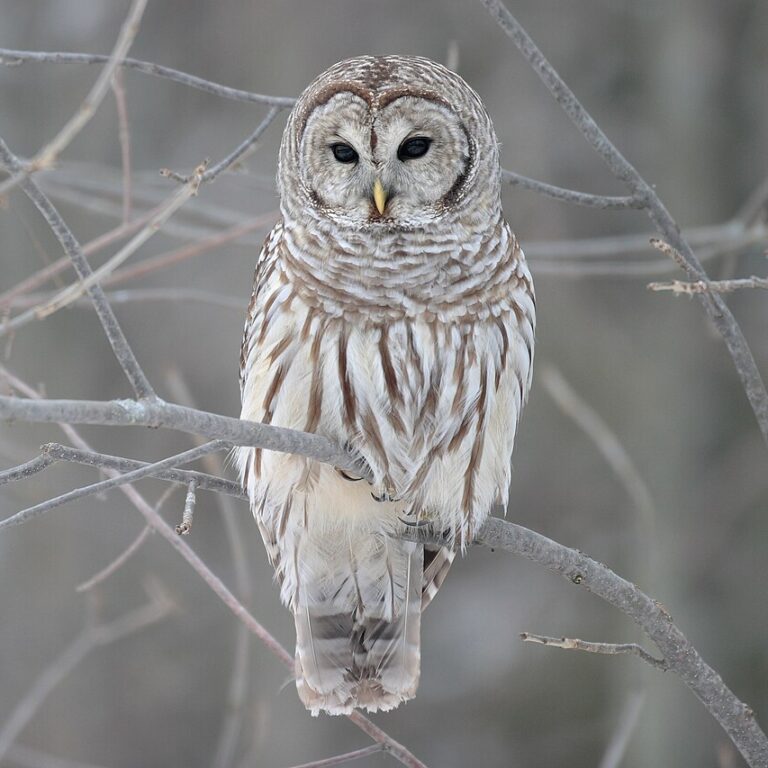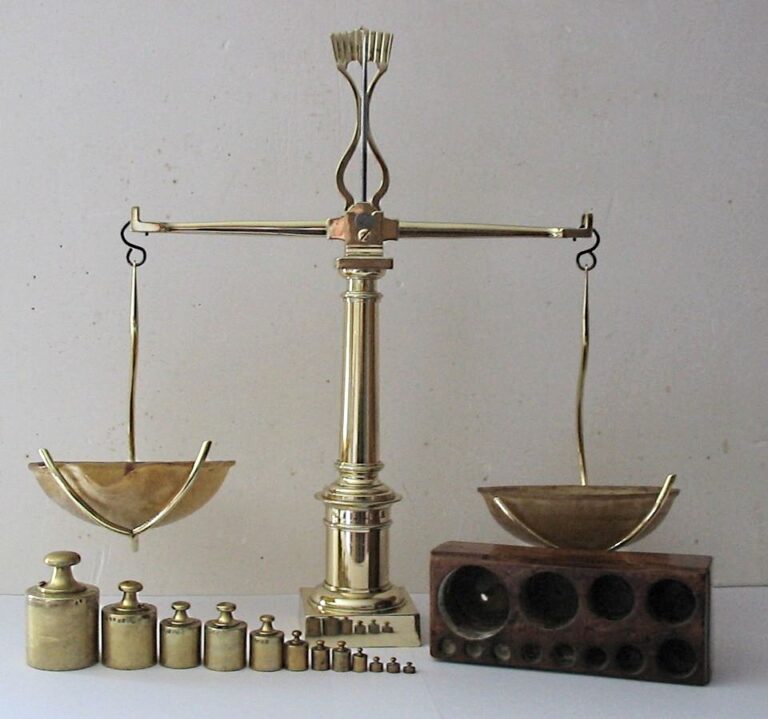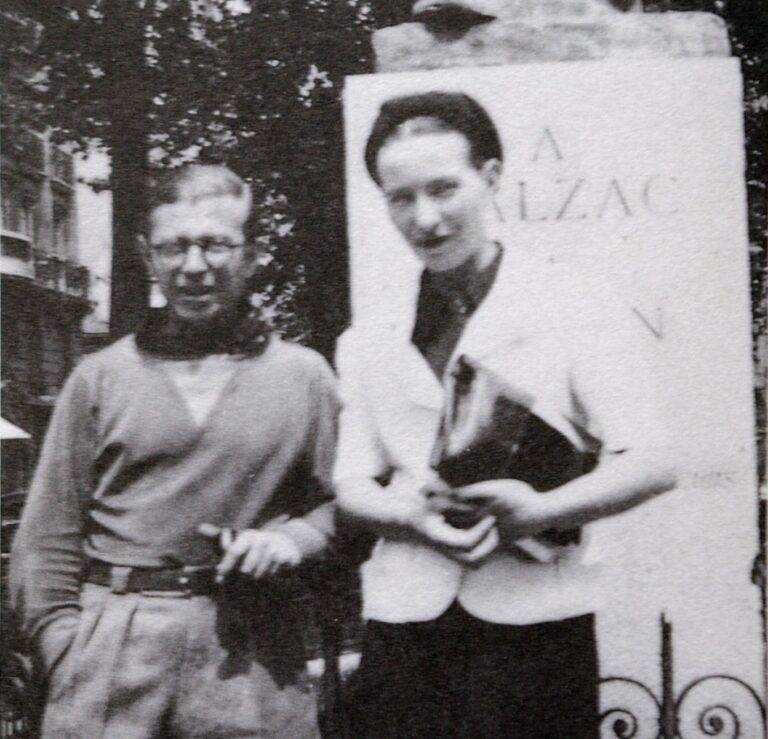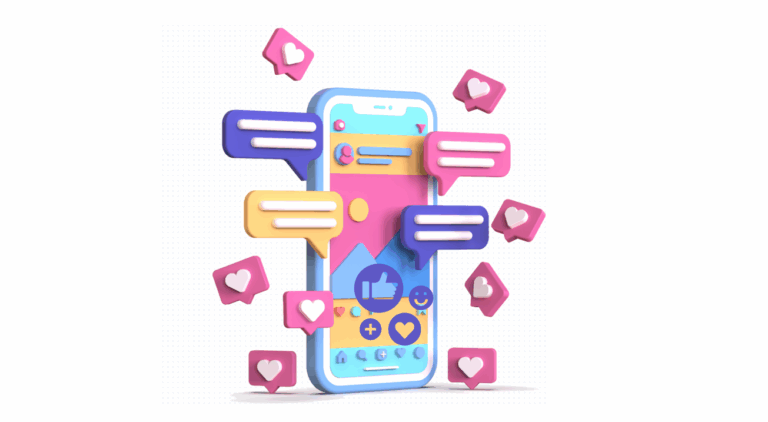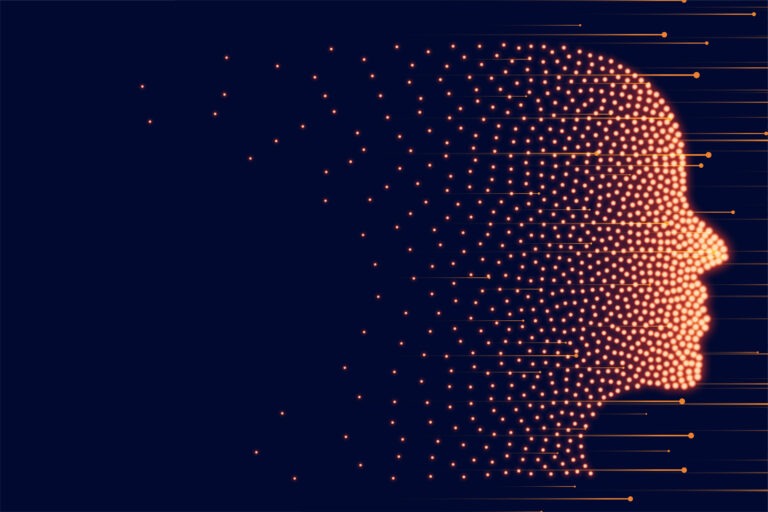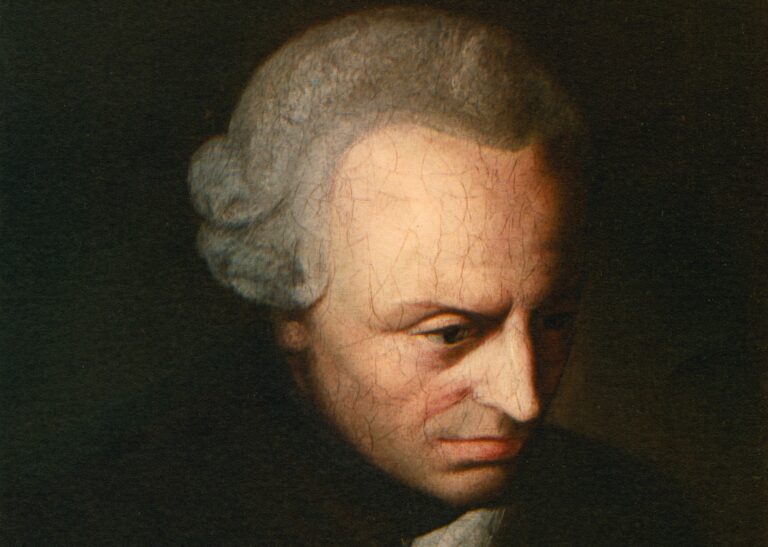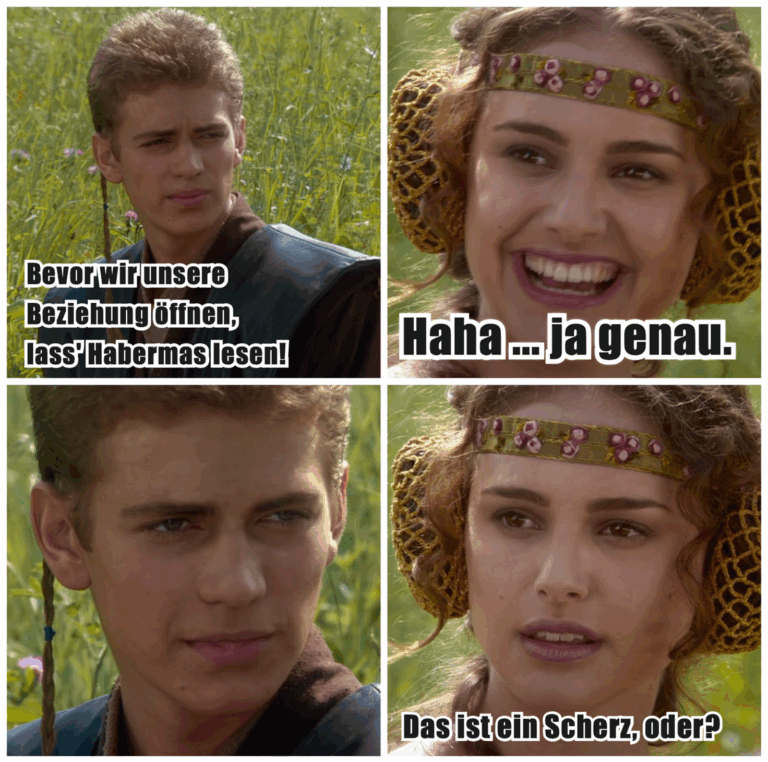Nostalgie. Ein Anti-Paradigma

Von Sandra Markewitz (Vechta) – Warum sehnen wir uns zurück? Was vermissen wir? Sind wir die Wesen, die sich erinnern wollen oder erinnern müssen? Nostalgie kommt in letzter Zeit öfter in der philosophischen Diskussion in den Blick, etwa bei Barbara Cassin, die kürzlich in Nostalgie. Wann sind wir wirklich zuhause?…